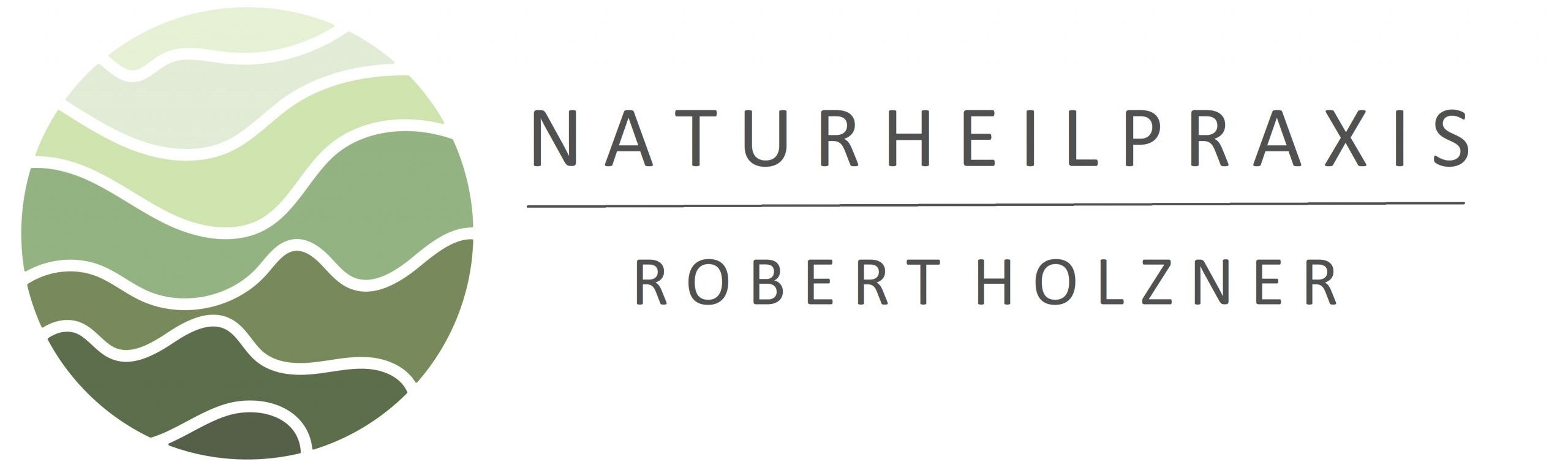Selen - Das unterschätzte Spurenelement
Kaum ein anderes Spurenelement hat solch einen wissenschaftlichen Wandel durchlebt wie das Selen. Noch vor einem knappen Jahrhundert wurde vor Selen als toxische und krebsauslösende Substanz gewarnt.
Heute wissen wir, dass Selen viele wichtige Funktionen im menschlichen Körper erfüllt und es im Gegenteil zu früheren Annahmen die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von bestimmten Erkrankungen sogar verringern kann.
Doch was steckt wirklich dahinter? Sollten Selenpräparate prophylaktisch eingenommen werden? Und wozu genau braucht unser Körper das Spurenelement eigentlich? Diese und viele weitere spannende Fragen werden im folgenden Blogartikel beantwortet.
Selen kommt in Pflanzen und in tierischen Produkten vor
Wie bereits erwähnt handelt es sich bei Selen um ein essentielles Spurenelement, welches der Mensch über die Nahrung aufnehmen muss.
Selen ist in einigen Pflanzen, wie Kohl- und Zwiebelgemüse, in Pilzen, Spargel sowie Hülsenfrüchten enthalten. Aber: der Selengehalt in Pflanzen hängt maßgeblich vom Selengehalt im Boden ab und kann daher stark schwanken. So enthalten die Ackerböden in den USA zum Beispiel mehr Selen, als die Böden hierzulande. Eine genaue Auskunft über die Menge an Selen in Pflanzen ist also nur schwer möglich.
Anders sieht es bei tierischen Produkten aus. Da Tierfutter in der EU seit 1992 mit Selen angereichert werden darf, weisen tierische Produkte wie Fisch, Fleisch oder Eier relativ konstante Selengehalte auf.


Doch wozu braucht der Körper überhaupt Selen?
Selen ist Bestandteil von verschiedenen Proteinen und damit an vielen Reaktionen in unserem Organismus beteiligt. So spielt das Spurenelement eine wichtige Rolle beim Schutz des Organismus vor Zellschädigung durch Radikale, da selenhaltige Enzyme in unserem Körper antioxidativ wirken. Des Weiteren regulieren selenhaltige Proteine den Schilddrüsen-Stoffwechsel und spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Immunregulation. Sogar die Fruchtbarkeit des Mannes hängt unter anderem von der Aktivität selenhaltiger Proteine ab, da diese einen wichtigen Baustein der Spermien darstellen.
Wie viel Selen braucht unser Körper?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) unterscheidet bei der Angabe ihrer Referenzwerte nach Alter, Geschlecht und Lebensumständen (z.B. Schwangerschaft, Stillzeit oder Grunderkrankungen).
Bei gesunden Männern ab einem Alter von 15 Jahren gibt die DGE einen Referenzwert von 70 µg Selen/Tag an, bei gesunden Frauen ab 15 Jahren, die weder schwanger sind noch stillen, liegt der Referenzwert bei 60 µg/Tag.
Wichtig zu erwähnen ist hierbei die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen Referenzwerten um Schätzwerte handelt. Dies hat den Hintergrund, dass für die Ermittlung der angegebenen Werte ein relativ neuer Biomarker im Blut herangezogen wurde, mit dessen Hilfe der Selenbedarf genauer bestimmt werden kann. Allerdings liegen für diesen Biomarker derzeit noch nicht ausreichend Studien vor, weshalb die DGE betont, dass die aktuellen Referenzwerte als Schätzwerte angesehen werden müssen.
Wie kommt es zu einem Selenmangel?
Im Großen und Ganzen kann zwischen zwei Ursachen für einen Mangel an Selen unterschieden werden:
1) eine zu geringe Aufnahme über die Nahrung oder
2) ein Mangel durch das Vorliegen bestimmter Erkrankungen wie beispielsweise Morbus Crohn oder
rheumatoide Arthritis.
Die Folgen eines gravierenden Selenmangels sind vielfältig. In der Literatur werden sogenannte typische Selenmangelerkrankungen beschrieben. Hierzu zählt z.B. die Keshan-Krankheit, die Kashin-Beck-Krankheit sowie der myxoedematöse Kretinismus, der in Kombination mit einem Iodmangel auftritt. Da diese Erkrankungen hierzulande so gut wie keine Rolle spielen, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Erläuterung verzichtet.
Einige Studien geben zudem Hinweise darauf, dass ein Selenmangel mit einem erhöhten kardiovaskulären (d.h. das Herz und die Gefäße betreffend) Risiko, dem vermehrten Auftreten von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse sowie mit einer erhöhten Karzinom-Inzidenz einhergeht.
Des Weiteren können bestimmte Erkrankungen, die zu einem akuten Selenmangel führen (z.B. eine Sepsis oder Viruserkrankungen) durch eben diesen Mangel eine weitere Verschlechterung erfahren. Dies ist auf die schlechtere Funktion des Immunsystems bei einem Selenmangel zurückzuführen.
Im Umkehrschluss legen Studien nahe: eine Selengabe kann unter gewissen Umständen das Krebsrisiko senken sowie den Verlauf bestimmter Erkrankungen, wie beispielsweise einer Sepsis, verbessern.
Darüber hinaus können niedrige Selenspiegel zu einer verminderten kognitiven Fähigkeit führen.
Relevanz für den Otto-Normalverbraucher
Nun stellt sich natürlich die Frage: welche Bedeutung haben die bisherigen Informationen für jeden einzelnen von uns/ für Sie persönlich? Ist eine Supplementierung von Selen generell sinnvoll? Wer sollte Selenpräparate einnehmen?
Diesen Fragen wird im Folgenden noch einmal genauer nachgegangen.
Schätzungen zur Folge liegt die durchschnittliche Selenzufuhr der deutschen erwachsenen Bevölkerung zwischen 31 und 66 µg/Tag. Dies liegt unter den von der DGE angegebenen Referenzwerten. Dennoch ist davon auszugehen, dass in Deutschland kein klinisch relevanter Selenmangel vorliegt, was bedeutet, dass die durchschnittlich geringere Selenaufnahme keine feststellbaren negativen gesundheitliche Effekte mit sich bringt. In Studien konnte gezeigt werden, dass ein erhöhtes Krebs- und kardiovaskuläres Risiko erst bei extrem niedrigen Selenspiegeln zu beobachten war.
Überdies ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass das Spurenelement Selen eine relativ geringe therapeutische Breite besitzt, was bedeutet, dass eine Selenüberdosis bzw. eine Selenvergiftung (Selenosis) durch die Einnahme zu hoher Selendosen durchaus leicht entstehen kann.
Abschließend lässt sich daher sagen, dass eine Einnahme von Selen nur in Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen sollte. Selbstverständlich gilt dies insbesondere für Patienten, die aufgrund bestimmter Erkrankungen von einer Selengabe profitieren können.
Ein therapeutischer Einsatz von Selen findet beispielsweise bei Patienten mit Hashimoto Thyreoiditis, mit Rheuma oder als begleitende Medikation bei Strahlentherapie oder der Behandlung mit Zytostatika statt.
Fazit und Ausblick in die Zukunft
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Spurenelement Selen eine wichtige Rolle bei einer Vielzahl von Prozessen in unserem Organismus spielt.
Die Funktionen sowie der therapeutische Einsatz von Selen sind nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung.
Selen sollte nur unter bestimmten Bedingungen und nur nach Rücksprach mit dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker eingenommen werden.
Fest steht: das Spurenelement Selen und sein Potenzial sind bei Weitem noch nicht vollständig erforscht und wir können gespannt darauf sein, welche Erkenntnisse die Forschung in den kommenden Jahren gewinnen wird.

Referenzen
1: Ulrich Schweizer, Josef Köhrle, Stefanie Schweizer: Supplementieren oder nicht? Das Spurenelement Selen, Perspectives in Medicine, Volume 2, Issues 1–4, 2014, Pages 72-78, ISSN 2211-968X, https://doi.org/10.1016/j.permed.2013.11.001.
2: Gärtner, Roland. „Die medizinische Bedeutung von Selen / The clinical relevance of selenium“ LaboratoriumsMedizin, vol. 30, no. 4, 2006, pp. 201-208. https://doi.org/10.1515/JLM.2006.037
3: Kieliszek M. Selenium⁻Fascinating Microelement, Properties and Sources in Food. Molecules. 2019 Apr 3;24(7):1298. doi: 10.3390/molecules24071298. PMID: 30987088; PMCID: PMC6480557.
4: BVL/ BfArM: Gemeinsame Expertenkommission zur Einstufung von Stoffen Stellungnahme zur Einstufung von selenhaltigen Produkten (Nr. 02/2021), 20. Dezember 2021
5: ärzteblatt: Selen nur auf ärztlichen Rat einnehmen. 12.02.2013, WWW: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/53397/Selen-nur-auf-aerztlichen-Rat-einnehmen (zuletzt aufgerufen am 27.04.2024)
6: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: Ausgewählte Fragen und Antworten zu Selen. März 2021.
7: K. Pohl: Selen: Zünder für Schilddrüse – und Spermien, PTA Forum, 30.06.2021, WWW: https://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/selen-zuender-fuer-schilddruese-und-spermien-126550/ (aufgerufen: 27.04.2024)